Südoldenburgs
Anteil an der Amerika-Auswanderung
-Vortrag von Franz-Josef Tegenkamp, Lohne vor der Oldenburgischen
Gesellschaft für Familienkunde in Oldenburg-
Wiedergegeben von Wolfgang Büsing in der Nordwest-Zeitung
vom 17. Mai 1997
Ergänzungen von Werner Honkomp, Oldenburg*
Auswanderung ist nicht erst ein Vorgang der Neuzeit, sondern so alt
wie die Menschheitsgeschichte. Von vorgeschichtlichen Wanderungsbewegungen
einmal abgesehen, finden wir in unserem Raum bereits im 5. Jahrhundert
Abwanderungen nach Britannien. Ebenso basiert die deutsche Ostkolonisation
während des Mittelalters auf auswanderungswilligen Siedlern auch aus
unserer Landschaft.
Im 16. und 17 Jahrhundert richtete sich der Blick wieder nach Westen.
Um den schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen zu entfliehen, suchten
immer wieder Einzelpersonen und Familien in den wohlhabenden Niederlanden
oder in Friesland eine neue Existenz.
Diese Auswanderung endete aber nach dem Dreißigjährigen
Krieg, da durch Kriegseinwirkungen sowie durch Mißernten und Seuchen
die hiesige Bevölkerung stark dezimiert war.
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte Nordwestdeutschland eine
erneute Abwanderung in bisher nicht gekanntem Ausmaß.
Im Oldenburger Münsterland, wo das Ältestenerbrecht herrschte,
hatte die Entstehung des Heuerleutewesens auch den nicht erbberechtigten
Bauernkindern zunächst noch die Möglichkeit einer bescheidenen
Existenzgründung in der Heimat geboten.
Als aber durch stete Bevölkerungsvermehrung und durch Preisverfall
der Ernteerträge die Schwierigkeiten zu Hause immer drückender
wurden, suchte man der Not sowie auch dem drohenden Militärdienst
zu entgehen, indem man dem längst praktizierten Beispiel vieler Süddeutscher
folgte und nach Nordamerika auswanderte. Es kursierten allerhand Briefe
und schwärmerische Berichte, die das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
in den verlockendsten Tönen priesen.
Wegen der traurigen Lage der hiesigen Heuerleute kann es eine zeitgenössische
Quelle "diesen armen Menschen nicht verargen, wenn sie den günstigen
Nachrichten aus Nordamerika trauen, die Beschwerden der Überfahrt
und der ersten Ansiedlung gering achten oder ganz verkennen, ihre geliebte
Heimat, Angehörige, gewohntes Leben und alles, was ihnen hier wert
sein mag, verlassen, um jenseits des Meeres eine andere und, wie sie hoffen,
bessere Heimat wiederzufinden".
Die Zahl der Auswanderer war beträchtlich. Beispielsweise zählte
man aus den drei Gemeinden Damme, Neuenkirchen und Holdorf, die gut 10000
Einwohner hatten, etwa 8000 Auswanderer. 95 Prozent der statistisch erfaßten
Auswanderer zog es in die Vereinigten Staaten. Dort ließen sie sich
häufig in geschlossenen Siedlungen nieder, die in ihrer Struktur den
heimischen Dörfern entsprachen.
Der Schwerpunkt der deutschen Siedlungen liegt dabei im amerikanischen
Mittelwesten. Die dortige Landkarte offenbart noch heute vertraute Ortsnamen
wie Bremen, Hannover, Oldenburg, New Minden, Westfalia usw., die an die
ursprüngliche Heimat in Europa erinnern.
Initiator der Auswanderung aus Südoldenburg war der ehemalige Lehrer
und Buchbinder Franz Joseph Stallo aus Damme, der 1831 mit seiner Familie
auswanderte und sich zunächst in Cincinnati niederließ. In zahlreichen
Briefen warb er für die Auswanderung und erreichte auch, daß
schon 1832 die erste Gruppe aus dem Raum Damme in Cincinnati eintraf. Hier
organisierte Stallo 150 Kilometer weiter nördlich im Staat Ohio die
Gründung einer deutschen Ansiedlung, die man anfangs Stallotown, später
Minster nannte. Dieser Ort wurde in den nächsten Jahren Ziel vieler
Auswanderer aus Damme.
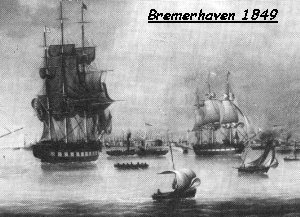 1846 verließ
auch die Familie Hermann Heinrich Tegenkamp aus Bahlen (Gemeinde Dinklage)
mit vier Kindern die Heimat. Der persönliche Besitz, soweit er nicht
mitgenommen werden konnte, wurde verkauft. Der Reiseweg ging über
Vechta, Wildeshausen und Delmenhorst nach Bremen. Über einen Agenten
war die Schiffspassage vorbestellt. Mit einem Weserkahn ging es zunächst
bis Bremerhaven, wo man in einen Überseesegler umstieg.
1846 verließ
auch die Familie Hermann Heinrich Tegenkamp aus Bahlen (Gemeinde Dinklage)
mit vier Kindern die Heimat. Der persönliche Besitz, soweit er nicht
mitgenommen werden konnte, wurde verkauft. Der Reiseweg ging über
Vechta, Wildeshausen und Delmenhorst nach Bremen. Über einen Agenten
war die Schiffspassage vorbestellt. Mit einem Weserkahn ging es zunächst
bis Bremerhaven, wo man in einen Überseesegler umstieg.
"Die 128 Emigranten füllten mit ihrer Habe das kleine Schiff zum
Erdrücken, aber fröhlicher Mut herrschte an Bord, denn es ging
ja jetzt nach Amerika."
Im Jahre 1846 verließen Bremerhaven 231 Schiffe mit 31.607 Passagieren
nach Nordamerika. Drei weitere Schiffe gingen nach Australien, zwei nach
Südamerika. Die Überfahrt über den Atlantik dauerte etwa
52 Tage. Die ungewohnte Schiffskost, mangelnde Sauberkeit, drangvolle Enge,
stürmische Witterung und Seekrankheit machten die Reise zu einem beschwerlichen
Abenteuer.
 Bevorzugter
Zielhafen in Nordamerika war New Orleans an der Mündung des Missisippi.
Von dort ging es flußaufwärts mit dem Dampfschiff bis St. Louis
und weiter über den Ohio bis Cincinnati, dem Ziel der meisten deutschen
Auswanderer. Bis zum Bau der ersten Eisenbahnlinien in den 1850er Jahren
war der Wasserweg die bequemste Reiseroute. Später landeten die Einwanderer
meist in den Hafenstädten der amerikanischen Ostküste und setzten
von hier aus die Reise mit der Eisenbahn fort.
Bevorzugter
Zielhafen in Nordamerika war New Orleans an der Mündung des Missisippi.
Von dort ging es flußaufwärts mit dem Dampfschiff bis St. Louis
und weiter über den Ohio bis Cincinnati, dem Ziel der meisten deutschen
Auswanderer. Bis zum Bau der ersten Eisenbahnlinien in den 1850er Jahren
war der Wasserweg die bequemste Reiseroute. Später landeten die Einwanderer
meist in den Hafenstädten der amerikanischen Ostküste und setzten
von hier aus die Reise mit der Eisenbahn fort.
Cincinnati blieb über Jahrzehnte das erste Ziel deutscher Auswanderer.
Viele hatten gerade die Überfahrt bezahlen können und ließen
sich für einige Zeit hier nieder, um Geld zu verdienen, mit dem sie
später eigenes Land erwerben wollten.
Die Familie Tegenkamp hatte indessen in St. Louis das Dampfschiff verlassen
und sich einer Familie Cohorst aus dem heimatlichen Nachbarort Schwege
bei Dinklage angeschlossen, um gemeinsam auf dem Landwege etwa 150 Kilometer
nach Osten bis zur deutschen Ansiedlung Teutopolis zu reisen, wo sie im
November 1846 eintrafen.
Teutopolis, noch heute "de dütske Stadt" genannt mit etwa 1200
Einwohnern, war 1839 von südoldenburgischen Siedlern gegründet
worden.
Das Überwiegend mit Urwald bedeckte Land mußte zunächst
gerodet werden. Man lebte anfänglich sehr bescheiden in Blockhütten.
Doch eine Schilderung aus dem Jahre 1842 besagt: "Die Ordnungs liebe, die
Sparsamkeit und der Fleiß der hiesigen Farmer wird Teutopolis bald
zu einem angenehmen und vergnügten Wohnplatz umgestalten.''
In der Regel erwarb jeder Siedler 40 Acre Land, was etwa 16 Hektar
entsprach. Eine schon 1840 erbaute schlichte Kirche wurde bereits um 1854
durch einen größeren Neubau ersetzt. 1858 erhielt Teutopolis
das erste Franziskanerkloster in den USA, gegründet als Missionsstation
von neun Ordensleuten aus Warendorf.
Bis zum Ersten Weltkrieg war das Plattdeutsche in Teutopolis die Umgangssprache,
auch in den Schulen wurde bis dahin nur Deutsch gesprochen.
Die Familie Tegenkamp siedelte sich in der Nähe von Teutopolis,
in Green Creek, Illinois an und konnte bis 1852 insgesamt 280 Acre (112
Hektar) eigenes Land erwerben, das zunächst unter Strapazen mühsam
urbar gemacht werden mußte.
Als der Familienvater Hermann Heinrich Tegenkamp 1891 im Alter von
86 Jahren starb, hinterließ er seinen sechs Söhnen eine stattliche
Farm. Deren Nachkommen leben noch dort und in einer deutschen Siedlung
in Kanada.
*Im Mai 1872 wanderte der Landarbeiter Johann-Herm-Hinrich Honkomp(19)
aus Brockdorf/Lohne aus. Vermutlich aufgrund günstiger Informationen,
ist ihm sein Bruder Bernd-Hinrich Honkomp(24) im Mai 1873 gefolgt.
Sie hatten eine etwas einfachere Anreise, da die "Geestebahn" 1862
fertiggestellt war. Bis dahin geschah die Weiterbeförderung von Bremen
zu den in Bremerhaven ankernden Seeschiffen auf kleinen, oft unzumutbar
Überfüllten Weserkähnen und dauerte bis zu drei Tagen. Auch
die Seereise war mit 14 Tagen viel kürzer und komfortabeler, da nunmehr
bereits dampfgetriebene Schiffe mit Hilfsbesegelung im Einsatz waren, und
ein regelmäßiger Liniendienst des Nordeutschen Lloyd durchgeführt
wurde.
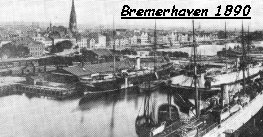 Die Brüder
Johann und Bernd fuhren beide mit der "LEIPZIG", mit etwa 850 weiteren
Auswanderern als "Zwischendeck-Passagiere" nach Baltimore. Von hier gab
es inzwischen eine Eisenbahnverbindung nach St.Louis am Missisippi, dem
"Tor zum Westen".
Die Brüder
Johann und Bernd fuhren beide mit der "LEIPZIG", mit etwa 850 weiteren
Auswanderern als "Zwischendeck-Passagiere" nach Baltimore. Von hier gab
es inzwischen eine Eisenbahnverbindung nach St.Louis am Missisippi, dem
"Tor zum Westen".
Nach einem Zwischenaufenthalt in Pennsylvania konnten sie in St.Louis
Fuß fassen. Dort hatten sie in der Nähe von St.Louis,in Clinton
County/Illinois, Farmland gepachtet.
Im März 1880 holten sie ihre Eltern Bernd-Henrich Honkomp(61)
und Anna-Margaretha(63) geb. Wilberding, Heuerleute bei Willenborg in Brockdorf/Lohne
nach. 1886 zog ihr Sohn Berhard mit ihnen dann weiter nach Florrisant am
Missouri, heute ein Vorort von St-Louis. Dort sind sie im Alter von 75
und 84 Jahren verstorben und auf dem "Sacret Heart" Friedhof begraben worden.
Die jährliche Auswanderungsrate hatte 1877 mit etwa 30.000 Personen
einen Tiefpunkt erreicht. 1880 waren es dann wieder 85.000, und stieg im
Jahre 1882 mit 250.000 Personen auf den absoluten Höhepunkt.
Johann Honkomp hatte auf der Schiffsreise im Mai 1872 Angelina(Lena)
Knelange(20) aus Crapendorf(Cloppenburg) kennengelernt. Ihre Schwester
Caroline Knelange(21) ist ihr im Juni 1882 mit zwei weiteren Schwestern
gefolgt.
 Johann Honkomp
und Angelina Knelange haben am 09.11.1875 in St.Louis in der katholischen
St.Liborius Kirche geheiratet. Bernd Honkomp und Caroline Knelange haben
am 09.11.1882 in St.Louis County/Missouri geheiratet.
Johann Honkomp
und Angelina Knelange haben am 09.11.1875 in St.Louis in der katholischen
St.Liborius Kirche geheiratet. Bernd Honkomp und Caroline Knelange haben
am 09.11.1882 in St.Louis County/Missouri geheiratet.
Johann und Angelina sind mit ihren 8 Kindern in St.Louis geblieben,
die zahlreichen Nachkommen haben dort ihre Spuren hinterlassen.
Bernd und Caroline sind mit ihren 6 Kindern 1906 nach Wichita-Falls
in Texas weitergezogen, weil die Luft am Missisippi zu feucht war. Sie
kauften dort Farmland und gründeten zusammen mit anderen Siedlern
eine katholische Kirchengemeinde.
Seitdem ist der Name Honkomp auch in Texas vielfach vertreten.
In einer amerikanischen Dokumentation der Familie Honkomp/Knelange wird
bei der Familie Bernhard Honkomp ein Kostgänger "Henry Tagenkamp,
65 years old, from Germany" erwähnt und als Nachlaß ein Gebetbuch
von ihm verwahrt.
Franz-Josef Tegenkamp -in dessen Besitz inzwischen das Gebetbuch ist-
ist davon Überzeugt, daß dieser "Tagenkamp" sein Ur-Groß-Onkel
ist, der 1868 ausgewandert ist.
Weitere Honkomp's, deren Ursprung in Steinfeld liegt, leben heute u.a.
in Cincinnati/Ohio, Iowa und Minneapolis/Minnesota mit jeweils einer eigenen
Auswanderungsgeschichte die noch zu erforschen sind.
Insgesamt werden heute in den USA über 120 Familien mit dem Namen
Honkomp gezählt, mehr als in Deutschland.
Durch die Forschungen haben die Tegenkamp's und Honkomp's die Verbindung
zur südoldenburgischen Heimat wiedergefunden.
Zurück zur Hauptseite
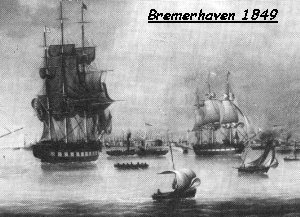 1846 verließ
auch die Familie Hermann Heinrich Tegenkamp aus Bahlen (Gemeinde Dinklage)
mit vier Kindern die Heimat. Der persönliche Besitz, soweit er nicht
mitgenommen werden konnte, wurde verkauft. Der Reiseweg ging über
Vechta, Wildeshausen und Delmenhorst nach Bremen. Über einen Agenten
war die Schiffspassage vorbestellt. Mit einem Weserkahn ging es zunächst
bis Bremerhaven, wo man in einen Überseesegler umstieg.
1846 verließ
auch die Familie Hermann Heinrich Tegenkamp aus Bahlen (Gemeinde Dinklage)
mit vier Kindern die Heimat. Der persönliche Besitz, soweit er nicht
mitgenommen werden konnte, wurde verkauft. Der Reiseweg ging über
Vechta, Wildeshausen und Delmenhorst nach Bremen. Über einen Agenten
war die Schiffspassage vorbestellt. Mit einem Weserkahn ging es zunächst
bis Bremerhaven, wo man in einen Überseesegler umstieg.
 Bevorzugter
Zielhafen in Nordamerika war New Orleans an der Mündung des Missisippi.
Von dort ging es flußaufwärts mit dem Dampfschiff bis St. Louis
und weiter über den Ohio bis Cincinnati, dem Ziel der meisten deutschen
Auswanderer. Bis zum Bau der ersten Eisenbahnlinien in den 1850er Jahren
war der Wasserweg die bequemste Reiseroute. Später landeten die Einwanderer
meist in den Hafenstädten der amerikanischen Ostküste und setzten
von hier aus die Reise mit der Eisenbahn fort.
Bevorzugter
Zielhafen in Nordamerika war New Orleans an der Mündung des Missisippi.
Von dort ging es flußaufwärts mit dem Dampfschiff bis St. Louis
und weiter über den Ohio bis Cincinnati, dem Ziel der meisten deutschen
Auswanderer. Bis zum Bau der ersten Eisenbahnlinien in den 1850er Jahren
war der Wasserweg die bequemste Reiseroute. Später landeten die Einwanderer
meist in den Hafenstädten der amerikanischen Ostküste und setzten
von hier aus die Reise mit der Eisenbahn fort.
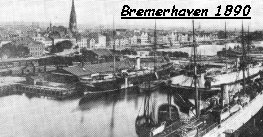 Die Brüder
Johann und Bernd fuhren beide mit der "LEIPZIG", mit etwa 850 weiteren
Auswanderern als "Zwischendeck-Passagiere" nach Baltimore. Von hier gab
es inzwischen eine Eisenbahnverbindung nach St.Louis am Missisippi, dem
"Tor zum Westen".
Die Brüder
Johann und Bernd fuhren beide mit der "LEIPZIG", mit etwa 850 weiteren
Auswanderern als "Zwischendeck-Passagiere" nach Baltimore. Von hier gab
es inzwischen eine Eisenbahnverbindung nach St.Louis am Missisippi, dem
"Tor zum Westen".
 Johann Honkomp
und Angelina Knelange haben am 09.11.1875 in St.Louis in der katholischen
St.Liborius Kirche geheiratet. Bernd Honkomp und Caroline Knelange haben
am 09.11.1882 in St.Louis County/Missouri geheiratet.
Johann Honkomp
und Angelina Knelange haben am 09.11.1875 in St.Louis in der katholischen
St.Liborius Kirche geheiratet. Bernd Honkomp und Caroline Knelange haben
am 09.11.1882 in St.Louis County/Missouri geheiratet.